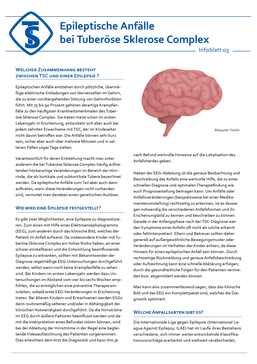Vereänderungen im Gehirn

Das Gehirn ist eines der bei Tuberöse Sklerose Complex am frühesten betroffenen Gewebe. Dort sind häufig höckerartige Veränderungen im Bereich der Hirnrinde, die als kortikale und subkortikale Tubera bezeichnet werden, zu finden. Man geht davon aus, dass sich diese Veränderungen schon während der Phase der Vermehrung und Verteilung der Nervenzellen beim Fötus bilden und somit bereits bei der Geburt angelegt sind.
Kortikale und subkortikale Tubera sind für die Entstehung der Epilepsie verantwortlich, von der 75 bis 90 Prozent der an Tuberöse Sklerose Complex Erkrankten betroffen sind. Epileptische Anfälle treten bei den meisten von ihnen schon im ersten Lebensjahr in Erscheinung, entwickeln sich aber auch bei jedem zehnten Erwachsenen mit Tuberöse Sklerose Complex, der im Kindesalter noch anfallsfrei war. Da epileptische Anfälle zum Teil auch ohne nachweisliche Tubera vorkommen, vermutet man daneben eine genetische Komponente als deren Ursache.
Bei epileptischen Anfällen unterscheidet man zwischen generalisierten Anfällen, die in den tiefen Hirnstrukturen entstehen und von Beginn an das gesamte Gehirn betreffen, sowie fokalen Anfällen, die von einem bestimmten Ort ausgehen und nur die in diesem Bereich gesteuerten Gehirnfunktionen beeinflussen. Daneben gibt es auch noch Anfälle mit unbekanntem Beginn.
Anfälle bei Tuberöse Sklerose Complex entsprechen in der Regel fokalen Anfällen. Sie können auch in einen generalisierten Anfall übergehen. Gehen sie von mehreren Tubern aus, spricht man auch von einer multifokalen Epilepsie. In Abhängigkeit ihres Entstehungsortes können sie ein ganz unterschiedliches Erscheinungsbild aufweisen. Um sie näher zu beschreiben, bedient man sich deswegen einer zusätzlichen Klassifizierung und unterteilt sie weitergehend in bewusst oder nicht bewusst erlebte Anfälle sowie in solche mit motorischem und nicht-motorischem Beginn.
Epileptische Anfälle führen nicht automatisch zu einer geistigen Behinderung. Infantile Spasmen, die bei Tuberöse Sklerose Complex gehäuft vorkommen und typischerweise zwischen dem dritten bis neunten, selten noch bis zwölften Lebensmonat auftreten, können bei längerem Dasein jedoch mit einem Entwicklungsstillstand bzw. -rückschritt einhergehen. Sie sind in der Regel durch einen motorischen Beginn gekennzeichnet, häufig in Form von symmetrischen Beuge- und Streckkrämpfen der Rumpfmuskulatur und der Extremitäten. Dabei kommt es zunächst zu kurzen, diskreten Nickbewegungen des Kopfes, mit einem anschließenden steifen (tonischen) Wegstrecken der Arme zur Seite über zwei bis zehn Sekunden, gefolgt von einem langsamen Zusammenführen über der Brust. Je nachdem welche Muskeln betroffen sind, ergeben sich durchaus aber auch andere Bewegungsmuster, die sich auf das alleinige Auftreten von unwillkürlichen Muskelzuckungen (Myoklonien) oder eine Versteifung der Muskulatur (tonische Elemente) beschränken können oder nur durch Blickabweichungen in Erscheinung treten.
Liegen infantile Spasmen in Kombination mit einer Hypsarrhythmie im EEG vor, spricht man auch von einem West-Syndrom. Im EEG sind dann von vielen Stellen im Gehirn ausgehende epilepsietypische Potentiale mit einer teilweise sehr hohen Generalisierungstendenz zu sehen. Daneben findet sich bei Tuberöse Sklerose Complex des Öfteren auch ein Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS), das durch ein völlig buntes Bild von nicht behandelbaren Anfällen und in den allermeisten Fällen durch deutliche Einschränkung der Kognition und Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit einer geistigen Behinderung gekennzeichnet ist. Ist ein West-Syndrom nicht behandelbar, kann dieses durchaus später in ein LGS übergehen. Jungen entwickeln mit 60 Prozent etwas häufiger ein LGS als Mädchen. Das Hauptmanifestationsalter liegt zwischen drei und fünf Jahren, ein Auftreten ist aber auch eher oder später möglich.
Werden eine Epilepsie oder Veränderungen im EGG festgestellt, werden zur Therapie je nach Befund zunächst anti-epileptische (antikonvulsive) Medikamente eingesetzt. Daneben steht mit Everolimus mittlerweile ein weiteres Medikament zur Verfügung, das durch seine mTor-hemmende Wirkung in einen grundlegenden molekularen Mechanismus der Erkrankung eingreift und in Kombination mit einer antiepileptischen Therapie zu einer Verbesserung der Anfallssituation beitragen kann. Helfen die Medikamente nicht oder nicht im gewünschten Umfang, stehen als weitere Therapieoptionen die modifizierte Atkins-Diät (MAD) als eine Sonderform der ketogenen Diät, die klassische ketogene Diät (KD), die Vagusnervstimulation (VNS) sowie die Epilepsiechirurgie zur Verfügung.
Weitere Veränderungen im Gehirn, die bei Tuberöse Sklerose Complex abseits der Tubera und der Epilepsie auftreten und Beschwerden verursachen können, sind sogenannte subependymalen Noduli (SEN). Dabei handelt es sich um kleine, knotenartige Wucherungen, die sich im Bereich der Seitenventrikel des Gehirns bilden und in die Ventrikelhöhle hineinragen können. Sie haben bei etwa 10 Prozent der Patienten eine Wachstumstendenz und entwickeln sich zu größeren, nicht oder nur wenig verkalkten, gutartigen Tumoren, die dann als subependymale Riesenzellastrozytome (SEGA) bezeichnet werden. Das Wachstum kann bis ins späte Jugendalter anhalten, bis es fast immer zu einem Wachstumstop und einer Verkalkung kommt. Behindern SEGAs die Abflusswege des Hirnwassers kann es zu einer Störung der Hirnwasserzirkulation und in der Folge zu einer Hirndruckerhöhung kommen, die sich typischerweise mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, insbesondere morgens nach dem Aufstehen, Unruhe oder in einer erhöhten Schläfrigkeit mit Eintrübung des Bewusstseins bemerkbar macht. Daneben können plötzliche neurologische Ausfälle, wie zum Beispiel Sehstörungen, Lähmungen, Gang- oder Koordinationsstörungen, auftreten. Kommt es nur zu einer allmählichen Drucksteigerung, so kann sich diese ausschließlich in einem veränderten Verhalten oder einer erhöhten Anfallsfrequenz äußern.
Um derartige Komplikationen zu verhindern, sollte deswegen mindestens bis zum 25. Lebensjahr und ggf. darüber hinaus eine regelmäßige kernspintomografische Kontrolle (MRT) erfolgen. Wird ein Eingreifen erforderlich, wird zur Verkleinerung des SEGAs heutzutage in der Regel eine medikamentöse Behandlung mit mTOR-Inhibitoren eingeleitet. Eine operative, neurochirurgische Entfernung des SEGAs ist nur noch in sehr seltenen Fällen erforderlich.